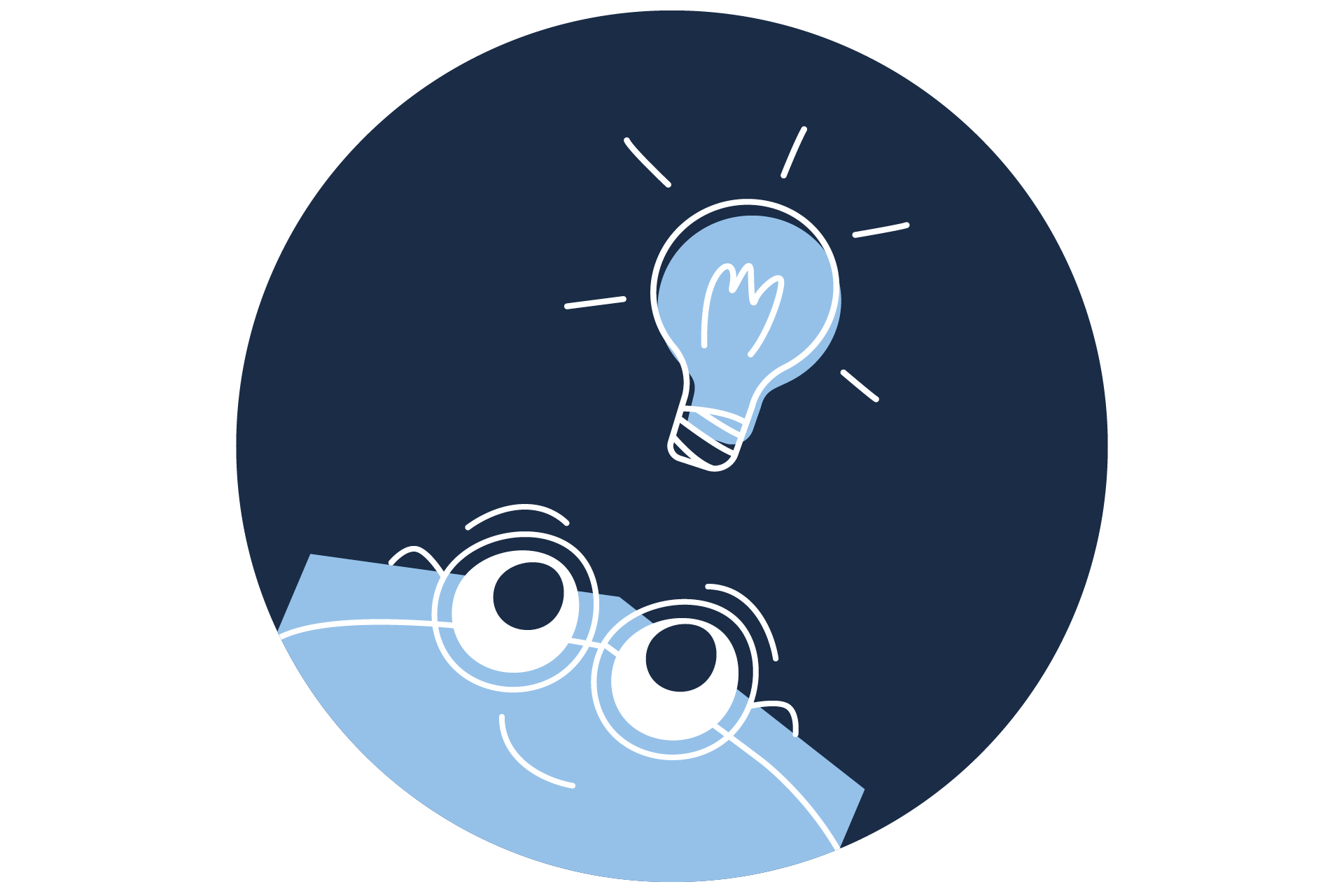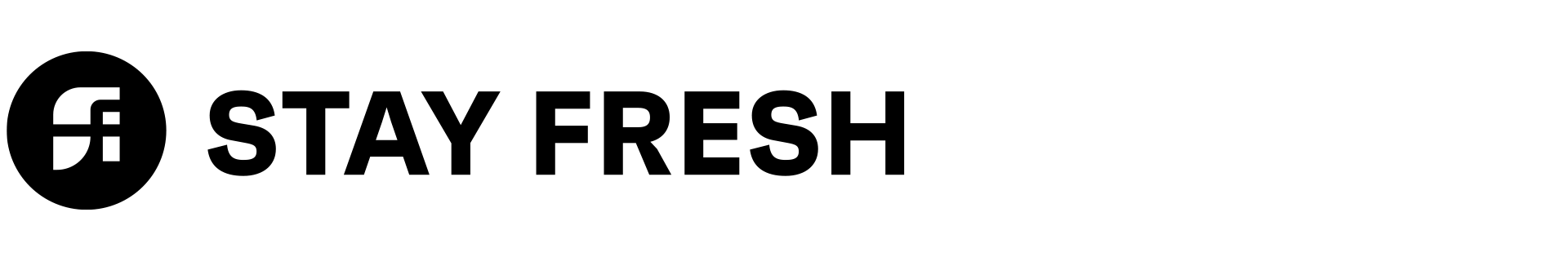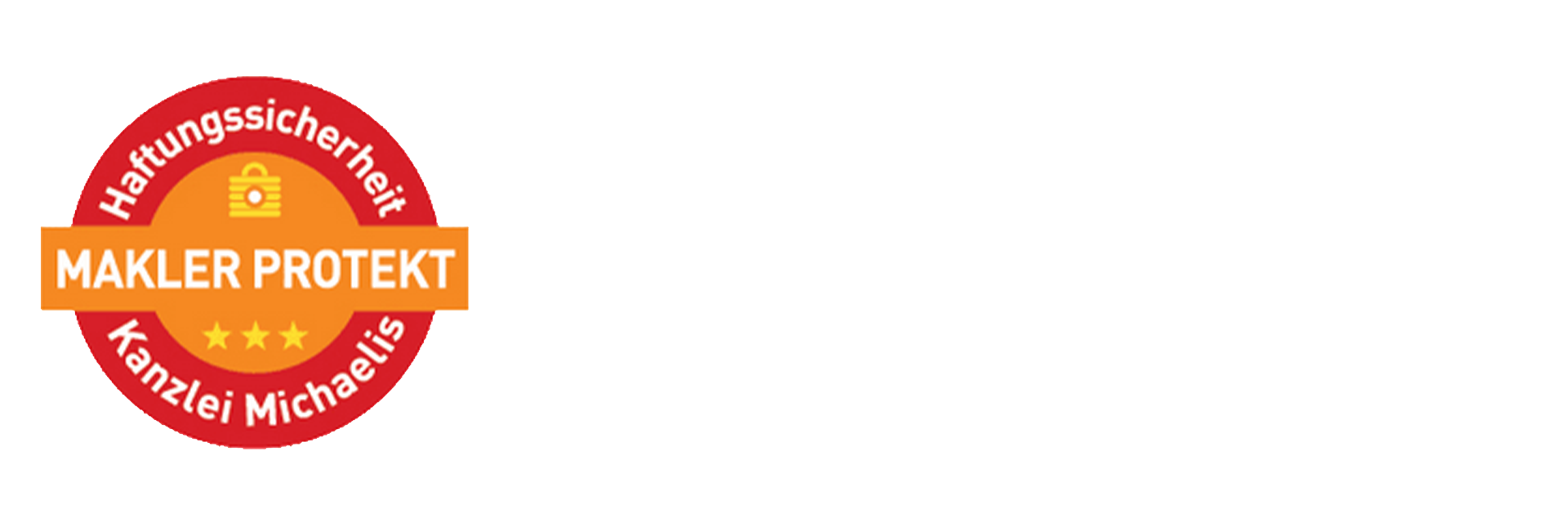Blogserie: Abwasserrohre sanieren - Der Ratgeber für Immobilienprofis
Herr Weber hatte die Wahl. Nach der Inspektion seiner Abwasserleitungen lag ihm ein klarer Befund vor: Die 40 Jahre alten Gussrohre (SML) wiesen an mehreren Stellen Korrosionsschäden auf. Zwei Angebote lagen auf seinem Schreibtisch. Das erste: Komplettaustausch mit Wanddurchbrüchen, Bauzeit acht Wochen, Kosten 38.000 Euro. Das zweite: Rohr-in-Rohr-Sanierung, Bauzeit zehn Tage, Kosten 19.500 Euro.
Als erfahrener Immobilieneigentümer wusste er, dass nicht nur der Preis zählt. Die acht Wochen Bauzeit bedeuteten Mietausfälle von mindestens 6.000 Euro. Hinzu kamen die Beschwerden seiner langjährigen Mieter, von denen bereits zwei beim ersten Angebot mit Auszug gedroht hatten. Am Ende entschied sich Herr Weber für die moderne, wirtschaftliche und nachhaltige Methode und hat diese Entscheidung nicht bereut.
In Teil 1 unserer Serie haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie Probleme mit Abwasserleitungen frühzeitig erkennen und welche versicherungsrelevanten Aspekte Sie beachten sollten. Heute vergleichen wir die beiden gängigen Sanierungsmethoden und helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche für Ihre Immobilie die richtige ist.
Die konventionelle Methode: Wenn alles aufgerissen wird
Die traditionelle Herangehensweise an eine Rohrsanierung ist der komplette Austausch der alten Leitungen. Dabei werden Wände, Böden und Decken geöffnet, die alten Rohre entfernt und durch neue ersetzt. Anschließend müssen alle Durchbrüche wieder verschlossen und die Oberflächen wiederhergestellt werden. Die Arbeit an mehreren Gewerken, deren Durchführung aufeinander abgestimmt werden muss, ist die Folge.
Diese Methode hat durchaus ihre Berechtigung und ist in manchen Fällen die einzig sinnvolle Lösung. Besonders wenn die Rohre so stark beschädigt sind, dass ihre strukturelle Integrität nicht mehr gegeben ist, oder wenn ohnehin umfassende Umbaumaßnahmen anstehen, kann ein Komplettaustausch die logische Wahl sein.
Baustelle im Wohnhaus: 6-8 Wochen im Detail
Die Bauzeit beträgt je nach Objektgröße mehrere Wochen bis Monate. Bei einem durchschnittlichen Mehrfamilienhaus mit drei Etagen sollten Sie mit mindestens sechs bis acht Wochen rechnen. Während dieser Zeit sind die betroffenen Wohnungen oft nicht oder nur eingeschränkt bewohnbar.
Der Ablauf gestaltet sich typischerweise so: Zunächst müssen die Handwerker Zugang zu den Leitungen schaffen, was bedeutet, dass Wände aufgestemmt, Böden aufgerissen und Decken geöffnet werden. Der entstehende Lärm durch Presslufthämmer und Bohrmaschinen ist erheblich. Es entstehen große Mengen Staub und Bauschutt, die durch das gesamte Treppenhaus transportiert werden müssen.
Nach dem Abbruch folgt die Demontage der alten Rohre und deren fachgerechte Entsorgung. Besonders bei älteren Gebäuden kann hier Asbest zum Vorschein kommen, was die Entsorgungskosten erheblich steigert und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordert.
Anschließend werden die neuen Rohre verlegt und angeschlossen. Erst danach beginnen die Wiederherstellungsarbeiten: Wände müssen verschlossen, verputzt und gestrichen werden. Böden müssen neu verlegt, Fliesen ersetzt werden. Diese Arbeiten binden verschiedene Gewerke ein, deren Koordination zusätzliche Zeit und Aufwand bedeutet.
Die wahren Kostenblöcke einer Sanierung
Die Gesamtkosten setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen, die viele Eigentümer zunächst unterschätzen:
Die reinen Materialkosten für neue Rohre sind dabei oft der kleinste Posten und machen etwa 15 bis 20 Prozent der Gesamtkosten aus. Die Arbeitskosten für Abbruch, Installation und Wiederherstellung schlagen allerdings deutlich höher zu Buche – sie machen häufig 50 bis 60 Prozent aus.
Hinzu kommen Entsorgungskosten für den Bauschutt. Pro Meter sanierter Leitung fallen etwa 40 bis 50 Kilogramm Abfall an – Gipskartonplatten, alte Fliesen, Putz, Mörtel und die alten Rohre selbst. Bei Sondermüll wie Asbest können die Entsorgungskosten pro Tonne auf über 1.000 Euro steigen.
Nicht zu vergessen sind die Mietausfälle während der Bauphase. Wenn Wohnungen mehrere Wochen nicht bewohnbar sind, summieren sich die Ausfälle schnell auf mehrere tausend Euro. Bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung mit einer Miete von 10 Euro pro Quadratmeter bedeuten zwei Monate Ausfall bereits 1.600 Euro.
Zusätzlich müssen Sie mit Mietminderungen für die bewohnbaren, aber beeinträchtigten Wohnungen rechnen. Bei einer mehrwöchigen Baustelle mit erheblichem Lärm und Staub sind Mietminderungen von 20 bis 30 Prozent durchaus üblich und rechtlich abgesichert.
Bei einem durchschnittlichen Mehrfamilienhaus steigen die Gesamtkosten oft bis in den mittleren fünfstelligen Bereich – wie im Fall von Frau Schneider aus Teil 1, deren Sanierung 45.000 Euro kostete.
Lärm, Staub und Kündigungen: Die Mieterperspektive
Ein Aspekt, der häufig unterschätzt wird, ist die Belastung für Ihre Mieter. Lärm von früh bis spät, Staubentwicklung trotz aller Schutzmaßnahmen und die Einschränkungen im Alltag führen regelmäßig zu Beschwerden. Für einen Verwalter bedeutet das einen erheblichen Koordinations- und Kommunikationsaufwand.
Die Erfahrung zeigt: Nicht selten kündigen langjährige Mieter aufgrund solcher Baumaßnahmen, was zu zusätzlichen Leerstandskosten und Aufwand bei der Neuvermietung führt. Der Verlust eines guten Mieters wiegt oft schwerer als die reinen Zahlen vermuten lassen.