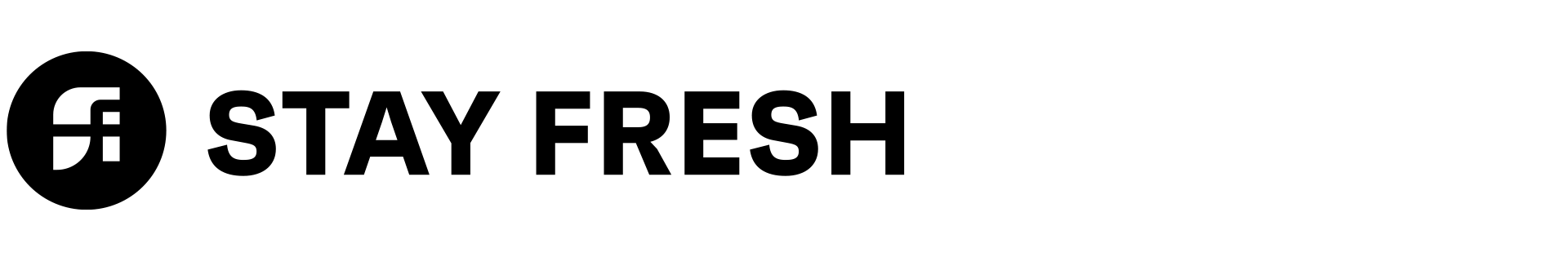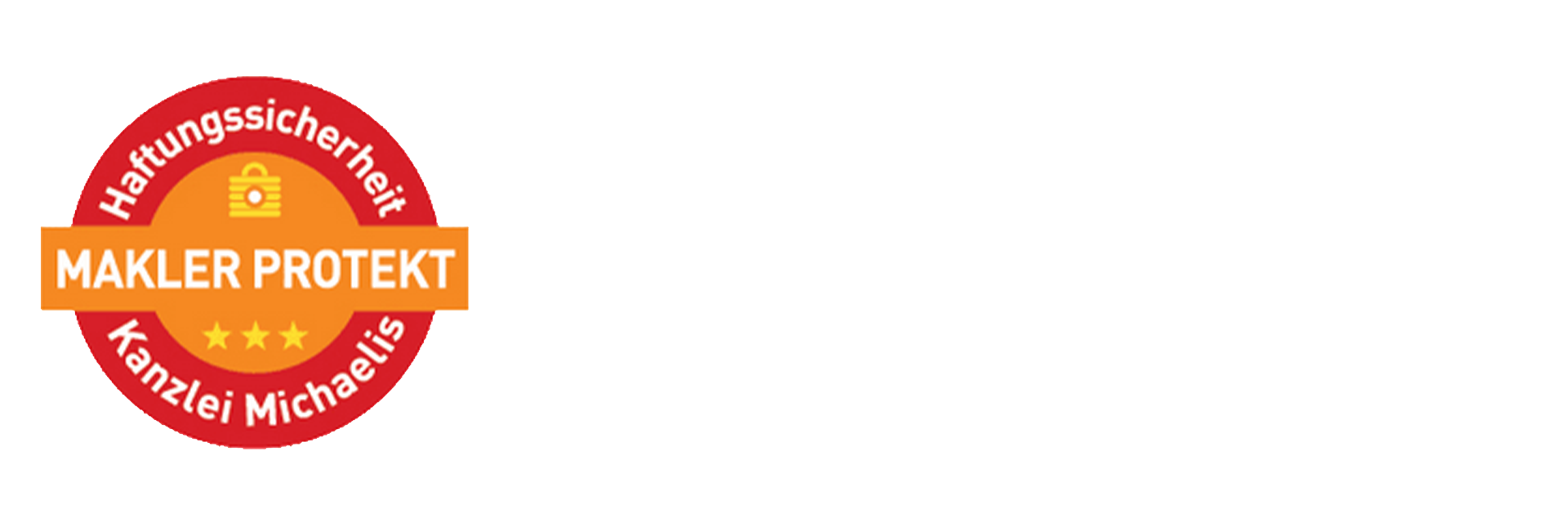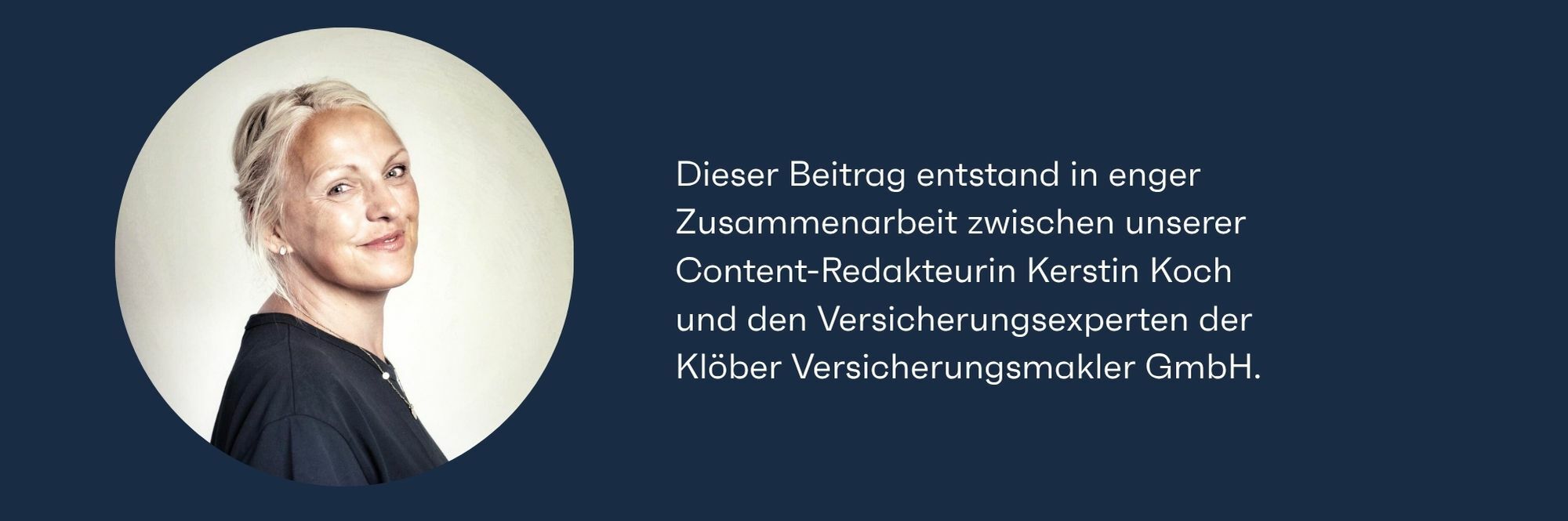
Die Geschichte bisher: Von der Schrecksekunde zur Kostenrechnung
In Teil 1 unserer Serie "Elementar wichtig" haben wir Familie Müller aus Erftstadt kennengelernt, die im Juli 2021 eine Hochwassernacht erlebte. Ihr Keller lief voll, doch sie hatten Glück – ihr Nachbar erlitt einen Totalschaden von 85.000 Euro. Der Grund: Ihre normale Wohngebäudeversicherung deckte die Elementarschäden nicht ab.
Teil 2 zeigte die überraschende Wahrheit über die Kosten: Während Familie Müllers Kellerschaden 14.500 Euro kostete, hätte umfassender Elementarschutz nur 156 Euro jährlich gekostet. Wir deckten auch die dramatischen psychischen Folgen auf – Flutopfer leiden bis zu neunmal häufiger an langfristigen Problemen.
Nun, in Teil 3, stellt sich die Frage: Warum ist die Absicherung gegen Elementarschäden in Deutschland so kompliziert?
Familie Müller im politischen Labyrinth
Sabine Müller klappt den Laptop zu und schüttelt den Kopf. Eine Stunde hat sie im Internet nach der aktuellen politischen Lage zur Elementarschadenversicherung gesucht. Das Ergebnis: Verwirrung pur. "CDU fordert Opt-Out-Modell, Ampel lehnt ab, Bundesrat drängt seit Jahren – verstehst Du das?", fragt sie ihren Mann Thomas.
Die Müllers stehen stellvertretend für Millionen Deutsche vor derselben Frage: Warum gibt es in Deutschland keine klare Regelung für den Schutz vor Naturkatastrophen? Während sie nach der Flutnacht längst ihre eigene Elementarschadenversicherung abgeschlossen haben, warten andere noch immer auf politische Lösungen.
"Das Problem", erklärt Kevin Klöber, Geschäftsführer der Klöber Versicherungsmakler GmbH, "ist ein jahrelanger politischer Stillstand. Jeder weiß, dass etwas passieren muss – aber niemand will die Verantwortung übernehmen." Die Folge: 46 Prozent aller deutschen Wohngebäude sind nach wie vor nicht gegen Elementarschäden versichert.
Politischer Hickhack: Was wirklich diskutiert wird
Die deutsche Elementarschadendebatte gleicht einem Ping-Pong-Spiel zwischen den Parteien. Im Juni 2024 lehnten die Ampel-Fraktionen einen CDU/CSU-Antrag ab, der eine entscheidende Wende hätte bringen können.
Der Unions-Vorschlag war konkret: Opt-Out-Modell im Neugeschäft – Wohngebäudeversicherungen nur noch mit Elementarschutz, den Kunden nach Aufklärung abwählen können. Im Bestand sollten alle Policen zu einem Stichtag erweitert werden, ebenfalls mit Abwahlmöglichkeit.
"Ein vernünftiger Kompromiss", urteilt Kevin Klöber. "Nicht die volle Pflicht, aber ein starker Anreiz zur Absicherung." Die Ampel-Koalition sah das anders und stimmte dagegen – ohne erkennbare Alternative anzubieten.
Bereits 2022 hatte die Ministerpräsidentenkonferenz die Bundesregierung zur Einführung einer Versicherungspflicht aufgefordert. Passiert ist nichts. Der Bundesrat erneuerte seine Forderung im Juni 2024 – wieder ohne Erfolg.
Die Blockade hat System: Die FDP lehnt jede Form der Versicherungspflicht kategorisch ab, die SPD schwankt, die Grünen sind unentschlossen. "Während die Politik diskutiert, steigen die Schäden Jahr für Jahr", kritisiert Kevin Klöber. "Das ist verantwortungslos gegenüber den Bürgern."
Besonders bitter: Selbst Verbraucherschützer und Versicherer sind sich einig, dass die aktuelle Situation unhaltbar ist. Doch die Politik findet keinen gemeinsamen Weg.

Die Argumente: Solidarität gegen Eigenverantwortung
Die Debatte offenbart einen tiefen gesellschaftlichen Graben zwischen zwei Philosophien.
Die Argumente für eine Pflichtversicherung:
Solidarität funktioniert nur mit allen. Je mehr Menschen versichert sind, desto günstiger wird es für jeden Einzelnen. "Risiko-Verteilung ist das Grundprinzip jeder Versicherung", erklärt der Verbraucherzentrale Bundesverband. Bei nur 54 Prozent Versicherungsquote zahlen zu wenige in den Topf ein.
Staatshilfen sind ungerecht. Wer sich nicht versichert, rechnet mit staatlichen Hilfen im Katastrophenfall. Das bedeutet: Steuerzahler finanzieren die Nachlässigkeit anderer. "Wer Solidarität will, muss sie auch leben", argumentieren Befürworter.
Prävention wird belohnt. Versicherer bieten Rabatte für Schutzmaßnahmen. Das schafft Anreize für Rückstausicherungen, hochwassertaugliche Heizungen oder sichere Elektroinstallationen.
Die Gegenargumente:
Zwang ist Bevormundung. Jeder soll selbst entscheiden, welche Risiken er eingehen will. "Der Staat ist nicht der bessere Hausherr", argumentiert die FDP.
Regionale Ungerechtigkeit. Warum sollen Hausbesitzer in Brandenburg für Hochwasserschäden am Rhein mitbezahlen? Die Risikoverteilung wirkt unfair.
Kostenfalle für Mieter. Höhere Versicherungskosten werden auf Mieten umgelegt. In Hochrisikogebieten könnte Wohnen unbezahlbar werden.
Kevin Klöber sieht beide Seiten: "Verstehen kann ich alle Argumente. Aber während wir diskutieren, entstehen täglich neue Schäden. Die Realität wartet nicht auf politische Kompromisse."
Lernen von den Nachbarn: Internationale Erfolgsmodelle
Ein Blick über die Grenzen zeigt: Es geht auch anders. Frankreich erreicht 98 Prozent Versicherungsquote – fast ohne Zwang.
Das französische Modell: Elementarschutz ist automatisch in jeder Wohngebäudeversicherung enthalten, kann aber abgewählt werden. Der psychologische Effekt ist enorm: Nur zwei Prozent verzichten darauf. "Die Lösung ist so einfach wie genial", bewundert Kevin Klöber das System.
Schweizer Pragmatismus: 19 von 26 Kantonen haben eine Elementarschadenpflicht eingeführt. Resultat: 95 Prozent Versicherungsquote und deutlich weniger staatliche Katastrophenhilfen.
Österreichs Weg: Kombiniert Anreize mit sanftem Druck. Wer nicht versichert ist, bekommt weniger staatliche Hilfe. Das motiviert zur Eigenvorsorge.
Die Erfolgsrezepte ähneln sich: Klare Regelungen, automatische Einschlüsse mit Abwahlmöglichkeit, reduzierte Staatshilfen für Nichtversicherte. "Deutschland könnte von diesen Modellen lernen", meint Kevin Klöber. "Aber dazu müsste die Politik handeln."
Besonders beeindruckend: In Frankreich kostet die Elementarversicherung durchschnittlich nur 12 Prozent der Gebäudeversicherungsprämie. Der Solidareffekt wirkt.
Familie Müller entscheidet – und handelt
Thomas und Sabine Müller haben ihre Lektion gelernt. "Wir warten nicht mehr auf die Politik", sagt Thomas beim Blick auf ihre neue Versicherungspolice. "156 Euro im Jahr für Seelenruhe – das ist jeden Cent wert."
Die Familie steht beispielhaft für einen Bewusstseinswandel: Immer mehr Deutsche erkennen, dass Eigenverantwortung der einzig verlässliche Weg ist. Die Versicherungsquote steigt langsam, aber stetig.
Konkrete Handlungsempfehlungen für Hausbesitzer:
Die Zukunft des Wohnens in Deutschland wird vom Klimawandel geprägt sein. Extreme Wetterereignisse werden häufiger und intensiver. "Wer heute sein Haus schützt, investiert in die nächsten Jahrzehnte", resümiert Kevin Klöber.
Familie Müller hat verstanden: In unsicheren Zeiten ist Eigenverantwortung die einzige verlässliche Konstante. Ihre Elementarschadenversicherung gibt ihnen das zurück, was das Hochwasser zu nehmen drohte: Sicherheit für ihr Zuhause.

Experten-Tipp:
"Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Nur 1,6 Prozent aller deutschen Immobilien liegen in echten Hochrisikogebieten - trotzdem haben fast die Hälfte aller Hausbesitzer keinen Elementarschutz. Selbst in Baden-Württemberg, dem Spitzenreiter mit 94 Prozent Versicherungsdichte, sind 6 Prozent ungeschützt. Das zeigt mir: Viele unterschätzen das Risiko von Starkregen, der überall auftreten kann. Mein Rat: Egal in welcher ZÜRS-Zone Sie wohnen - Elementarschutz ist heute unverzichtbar."
Kevin Klöber, Geschäftsführer Klöber Versicherungsmakler GmbH
Sie möchten wie Familie Müller vorsorgen und nicht länger auf die Politik warten?
Als unabhängige Versicherungsmakler kennen wir die Unterschiede zwischen den Tarifen genau. Während die Politik diskutiert, handeln wir – und finden für Sie die optimale Absicherung zu fairen Konditionen. Egal ob Sie in ZÜRS-Zone 1 oder 4 wohnen: Wir haben Lösungen.
Informieren Sie sich über unsere Wohngebäudeversicherung oder vereinbaren Sie direkt eine kostenlose Beratung. Wir beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auch in unserem Artikel "Wohngebäudeversicherung im Versicherungs-1x1" – perfekt für alle, die ihre Absicherung von Grund auf verstehen möchten.

Häufig gestellte Fragen zur Elementarschadenversicherung
Ist eine Elementarschadenversicherung in Deutschland Pflicht?
Nein, aktuell (07/2025) ist sie freiwillig. Die Politik diskutiert seit Jahren über eine Pflichtversicherung, aber es gibt noch keine verbindlichen Beschlüsse. Hausbesitzer sollten daher selbst handeln.
Was bedeutet das Opt-Out-Modell, das die CDU fordert?
Beim Opt-Out-Modell wäre Elementarschutz automatisch in jeder Wohngebäudeversicherung enthalten. Kunden könnten nach Aufklärung darauf verzichten. Dieses Modell erreicht in anderen Ländern deutlich höhere Versicherungsquoten.
Warum hat Deutschland keine Pflichtversicherung wie andere Länder?
Die politischen Parteien sind uneins: Die FDP lehnt jede Pflicht ab, die SPD fürchtet Mehrkosten für Mieter, die Grünen schwanken. Diese Blockade verhindert seit Jahren eine Lösung.
Wie erreicht Frankreich 98% Versicherungsquote ohne harte Pflicht?
Frankreich macht es clever: Elementarschutz ist automatisch enthalten, kann aber abgewählt werden. Nur 2% verzichten darauf. Zusätzlich gibt es weniger staatliche Hilfe für Unversicherte.
Kann ich staatliche Hilfe erwarten, wenn ich nicht versichert bin?
Nur begrenzt. Staatshilfen fließen nur bei offiziell anerkannten Katastrophen und decken meist nur 80% der Schäden. Bei lokalen Ereignissen gehen Sie oft leer aus.
Was kostet Elementarschutz in anderen ZÜRS-Zonen?
Die Kosten variieren stark: Zone 1 ab 50€/Jahr, Zone 2 bis 180€/Jahr, Zone 3 bis 350€/Jahr, Zone 4 bis 800€/Jahr mit individueller Prüfung. Auch innerhalb der Zonen gibt es große Preisunterschiede zwischen den Versicherern.
Wann sollte ich eine Elementarschadenversicherung abschließen?
Sofort! Kevin Klöber prognostiziert: "Politisch wird sich nichts grundlegendes ändern." Das Wetter wartet nicht auf Bundestagsdebatten. Wer heute abschließt, sichert sich günstige Konditionen und ist vor der nächsten Unwettersaison geschützt.